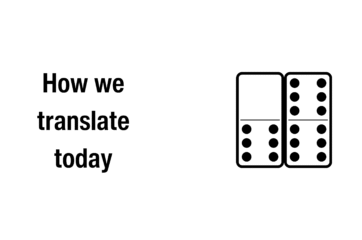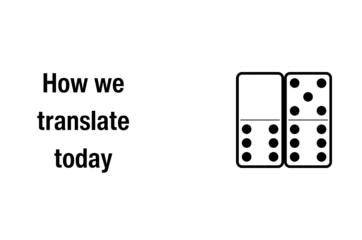Inklusive Sprache im Deutschen:
Wie setzt man sie im Unternehmen um?
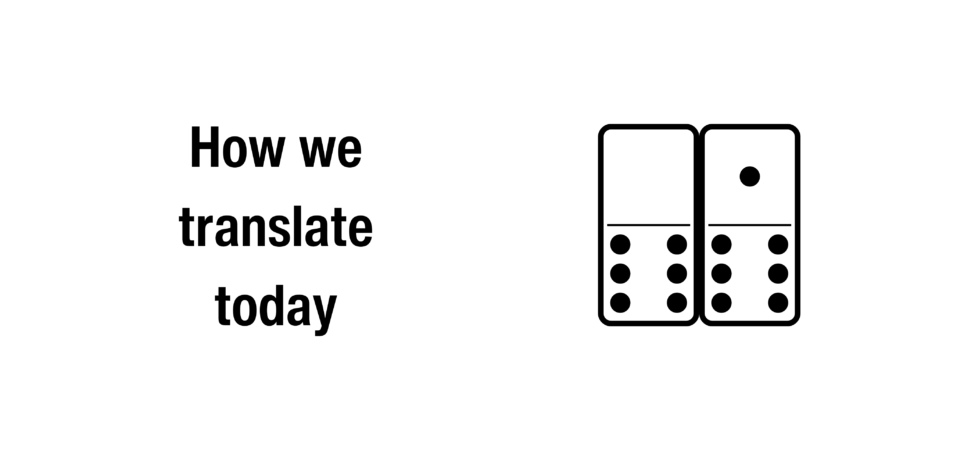
Inklusive Sprache ist ein Thema, das seit einigen Jahren immer wieder in den Vordergrund rückt. Paarform, generisches Maskulinum, Gendersternchen? Es gibt eine Fülle von Leitfäden zu diesem Thema. Jede Institution oder jedes Unternehmen kann die inklusive Schreibweise auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Ausmass anwenden.
Wussten Sie, dass sich weniger Frauen bewerben, wenn die Stellenanzeige im generischen Maskulinum geschrieben ist? Ihnen könnten dadurch hervorragende Bewerbungen durch die Lappen gehen. Auch potenzielle Kundschaft könnte sich möglicherweise nicht angesprochen fühlen, wenn Ihr Text nur in der männlichen Form geschrieben ist.
Erfahren Sie, wie Sie inklusive Sprache in Ihrem Unternehmen einführen und wie SwissGlobal Sie bei diesem Prozess unterstützen kann.
Was ist inklusive Sprache und warum sollte man sie verwenden?
Die inklusive Sprache bzw. die inklusive Schreibweise zielt darauf ab, Geschlechterdiskriminierung in der Sprache zu vermeiden. Entsprechend verwenden Sie sie in Ihrer externen als auch in Ihrer internen Kommunikation und prägen somit den Aufbau Ihrer Unternehmensidentität.
Natürlich steht es Ihnen frei, inklusive Sprache zu verwenden oder nicht. Jedes Unternehmen wählt seine eigene Kommunikationsstrategie. Als Sprachdienstleister ist es nicht unser Ziel, eine politische Botschaft zu vermitteln, sondern Sie darauf aufmerksam zu machen, dass es in der Schweiz viele verschiedene Schreibvarianten und fast ebenso viele Zielgruppen gibt.
Un peu d’histoire
Le français n’a pas toujours fait primer le masculin sur le féminin, comme nous l’avons entendu dès l’entrée à l’école primaire. Jusqu’au XVIIe siècle, la féminisation des noms et des professions allait de soi. Mais les grammairiens, désireux d’exclure les femmes de certaines professions, en ont décidé autrement. Claude Favre de Vaugelas décréta dans ses Remarques sur la langue française (1647) que « le genre masculin, étant le plus noble, [devait] prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se [trouvaient] ensemble ».
L’accord de proximité perdura toutefois jusqu’au XIXe siècle, qui veut qu’on accorde l’adjectif avec le substantif le plus proche qu’il qualifie. La règle dite du masculin générique a progressivement invisibilisé les femmes de la langue (on ne parlait même pas de minorités de genre à l’époque).
Or, même si nous apprenons dès notre plus jeune âge que le masculin générique inclut tous les genres, des études ont révélé que le cerveau arrive difficilement à assimiler cette interprétation : utiliser le masculin générique entraîne la formation d’images mentales majoritairement composées d’hommes.
Techniken der inklusiven Schreibweise
Inklusive Schreibweise bedeutet nicht, einfach nur einen Doppelpunkt zu verwenden, um die Unterscheidung sichtbar zu machen. Die deutsche Sprache muss nicht zwingend auf Neologismen zurückgreifen, um Sätze inklusiv zu formulieren.
Bereits vorhandene sprachliche Mittel
- Neutrale Wörter und Formulierungen. Idealerweise verwendet man die geschlechtsneutrale Form der Wörter: die/der Forschende, die Person, das Mitglied, Beschäftigte (nur im Plural). Neutrale Formulierungen oder Kollektivbezeichnungen: das Personal, die Lehrkräfte, die Schulleitung
- Substantivierung von Partizipien oder Adjektiven: die Mitarbeitenden, die Studierenden (nur im Plural anwendbar)
- Paarformen (Vollform): Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Direktorinnen und Direktoren, wobei alternativ auch abgewechselt werden kann (mal die Mitarbeiterinnen, mal die Mitarbeiter)
- Umschreibungen (im Passiv/mit Adjektiv/mit Partizip II/mit substantiviertem Verb): Jeder muss das Formular rechtzeitig einreichen à Das Formular ist rechtzeitig einzureichen; die Hilfe eines Arztes à ärztliche Hilfe; Autor à geschrieben von; Die Teilnehmer sind berechtigt, die Räumlichkeiten frei zu nutzen à die Teilnahme berechtigt dazu, die Räumlichkeiten frei zu nutzen
Neologismen
- Typografische Elemente wie Genderstern, Genderdoppelpunkt oder Gender Gap: Übersetzer*innen, Teilnehmer:innen, Student_innen. Damit wird das gesamte Spektrum der Geschlechteridentitäten angesprochen. In deutschsprachigen Texten des Bundes sind aber diese sogenannten Genderzeichen beispielsweise nicht zugelassen.
- Neubildungen: *das Elter (für Mutter oder Vater), Neopronomen wie «xier» oder «dey». Diese Wörter schliessen auch non-binäre Menschen ein. Solche Neubildungen sind im Deutschen jedoch eher eine Seltenheit.
Wie Sie in Ihrem Unternehmen eine inklusive Sprache einführen können
Idealerweise erstellen Sie zunächst einen Sprachleitfaden, der beim Verfassen jeglicher Beiträge eingehalten werden muss. Der Schlüssel zum Erfolg ist Konsistenz: Entscheiden Sie sich für eine oder mehrere Formen der inklusiven Schreibweise, die Sie übernehmen möchten, und halten Sie sich daran. Indem Sie Ihr Zielpublikum genau definieren, können Sie die am besten geeignete Variante der inklusiven Sprache wählen.
Schulen Sie die Personal- und Kommunikationsabteilungen zu diesem Thema und informieren Sie das gesamte Unternehmen. Überarbeiten Sie nach und nach interne Dokumente wie Reglemente und Stellenanzeigen.
Danach kümmern Sie sich um die Kommunikationskanäle: Passen Sie Geschäftsunterlagen, die Website, die Broschüren usw. an.
Zögern Sie nicht, diese Änderung in der Kommunikation an Informationsveranstaltungen vorzustellen, um Ihr Personal zu sensibilisieren. Inklusive Sprache kann sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form angewendet werden.
Erstellen Sie dafür einen Styleguide, der unter anderem Richtlinien zur inklusiven Schreibweise, aber auch weitere Informationen zum Verfassen und zur Präsentation von Texten enthält. Ihr Sprachdienstleister kann dies für Sie übernehmen.
Inklusive Sprache und Übersetzung
Kommunizieren Sie in mehreren Sprachen?Es ist sinnvoll, Ihre Strategie in den verschiedenen Sprachen auszuarbeiten.
Sie variiert nämlich je nach Sprachsystem: Im Französischen verwendet man zum Beispiel den Medianpunkt als kompakte Formulierung, im Deutschen eher den Doppelpunkt, wobei hier sehr häufig Neologismen zum Einsatz kommen, um dem Trend zur Inklusivität zu folgen: Mitarbeitende anstelle von Mitarbeiter, zum Beispiel. Im Französischen ist dies nicht wirklich etabliert. Das Englische ist bereits sehr neutral und erfordert in der Regel nur wenige Anpassungen (Beispiel: Chairman à Chairperson).
Informieren Sie sich in jedem Fall über die Kultur des Zielpublikums und über bewährte Praktiken in Bezug auf die inklusive Schreibweise. Ein Sprachdienstleister wie SwissGlobal wird Sie dabei unterstützen.
Inklusive Sprache bei dolmX
Wir haben Nielufar Saffari, CEO von dolmX, einer Plattform für interkulturelles Dolmetschen, gebeten, uns den Einsatz inklusiver Sprache in Ihrem Unternehmen zu erklären.
SwissGlobal: Liebe Nielu, könntest du kurz dolmX kurz vorstellen?
Nielufar Saffari: «dolmX ist eine Plattform für Videodolmetschen, die 2021 mit dem Ziel gegründet wurde, einerseits den Zugang zu professionellen Dolmetschern auf zu erleichtern. Andererseits möchten wir für Gleichberechtigung sorgen, indem wir professionelle Dolmetscher sowie öffentliche Dienstleistungen für alle zugänglich machen. Jede Person im Krankenhaus weiss, dass sie verstanden wird.»
SG: Wie geht ihr intern vor, um inklusiv zu formulieren? Habt ihr diesbezüglich Richtlinien?
NS: «Bei uns ist Inklusivität nicht wirklich ein Diskussionspunkt. Für uns ist es klar, dass wir eine inklusive Sprache verwenden, weil wir mit Sprache Sichtbarkeit schaffen und diese dadurch verbessern wollen. Dolmetscher verwenden die Sprache als Werkzeug. Daher ist es für uns selbsterklärend.
Wie können wir Veränderungen in der Welt bewirken, wenn wir nicht bei der Sprache anfangen? Denn die Sprache schafft Bilder. Und mit Bildern erschaffen wir Realitäten. Wenn wir bestimmte Menschen durch Sprache ausschliessen, verwehren wir diesen Menschen das Recht auf ein gleichberechtigtes Leben.»
SG: Inklusive Sprache unterscheidet sich von Sprache zu Sprache. Bevorzugt ihr eine bestimmte Variante? Und weshalb?
NS: «Wir haben uns für den Doppelpunkt entschieden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, inklusive Sprache anzuwenden. Im Deutschen kann man auch ein Sternchen oder das sogenannte Binnen-I verwenden. Den Doppelpunkt verwenden wir, weil es einfacher ist, beim Sprechen eine Pause einzulegen, aber auch aus ästhetischen Gründen, weil es im Text besser aussieht. Damit möchten wir sicherstellen, dass alle anderen Geschlechter oder Identitäten angesprochen werden, nicht nur die binären. Wenn wir keinen Doppelpunkt verwenden, sprechen wir immer in der weiblichen Form, verwenden also das generische Femininum.»
Schlussfolgerung
Mithilfe inklusiver Sprache kann man nicht nur einbeziehen, sondern vermittelt auch die Werte eines engagierten Unternehmens. Die Zeit ist wieder reif für die Sichtbarmachung mittels Sprache. Wenn Sie inklusive Sprache einführen oder dies auf methodischere Weise tun möchten, informieren Sie sich über Möglichkeiten und bewährte Verfahren in Ihrem Sprachraum und überlegen Sie, was für Sie und Ihre Produkte und Dienstleistungen am besten geeignet ist.
SwissGlobal hilft Ihnen, inklusive Sprache zu verwenden. Unsere Fachleute können Sie optimal beraten und Sie bei Ihrer inklusiven Kommunikation unterstützen, sei es mehrsprachig oder nicht, damit diese Ihren Erwartungen entspricht und natürlich klingt. Wenn Sie den Schritt wagen, kontaktieren Sie uns!
Einige Referenzen für weitere Inputs:
-
Inklusive Sprache
Übersetzung