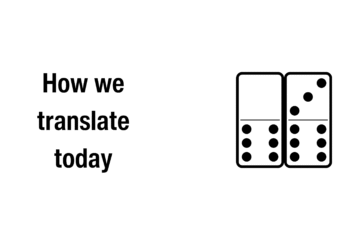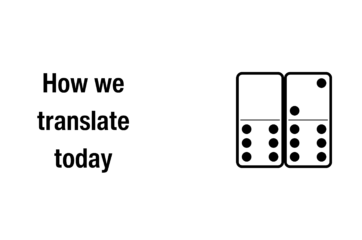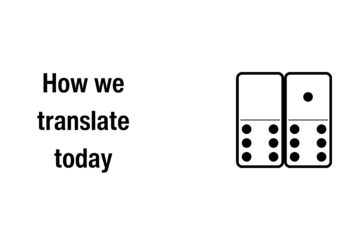Die Geschichte der Übersetzung – von Keilschrift bis KI
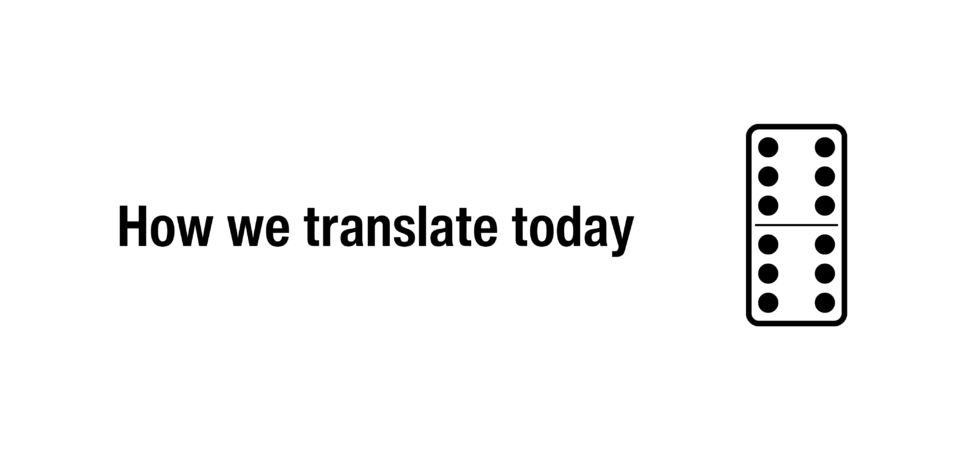
Haben Sie sich je gefragt, wann denn zum allerersten Mal etwas übersetzt wurde? Anlässlich des Sprachgewirrs am Turm von Babel? Oder auf einem Tontäfelchen im Zweistromland? Schon lange vor maschineller Übersetzung und KI bezwangen Menschen die Sprachbarrieren zwischen Weltreichen und Glaubensrichtungen oder auch entlang der grossen Handelsstrassen.
Eine Entdeckungsreise durch vergangene Jahrhunderte deckt auf, wie Übersetzung unsere Welt von heute geprägt hat. Vom antiken Schreiber bis hin zum modernen Linguisten entfaltet sich eine Geschichte von Kommunikation, Kultur und ständiger (R-)Evolution.
1. Tontafeln, Keilschrift und frühe zweisprachige Texte (ca. 2000 vor Christus)
Die Geschichte der Übersetzung kann zurückverfolgt werden nach Mesopotamien, etwa ins Jahr 2000 vor Christus. Zweisprachige Tontafeln, auf denen in Sumerisch und Akkadisch Handelsabkommen, Eigentumsrechte oder Rituale festgehalten sind, dienen als frühe Beispiele für Übersetzung. In einer vielsprachigen Gesellschaft fungierten die Schreiber, die sie verfassten, als unverzichtbare Vermittler.
Das «Gilgamesch-Epos», einer der ältesten literarischen Texte der Welt, war – übersetzt in zahlreiche Sprachen – im ganzen mesopotamischen Reich verbreitet.
Die frühen Übersetzer dieser Ära waren in der Regel in Palästen oder Tempeln beschäftigte Schreiber. Ihre Aufgabe bestand nicht nur darin, Sprache umzusetzen, sondern darin, Inhalte dem jeweiligen kulturellen und rechtlichen Kontext anzupassen.
Die Entwicklung von zweisprachigen «Wörterbüchern» auf Tontafeln – frühen Vorläufern der Glossare und Terminologiedatenbanken, die wir heute kennen – beweist einen strukturierten Übersetzungsansatz.
2. Staatsverträge und Diplomatie in zwei Sprachen (ca. 1259 vor Christus)
Einer der frühesten historisch gesicherten Staatsverträge, der Ägyptisch-Hethitische Friedensvertrag (um 1259 vor Christus), wurde sowohl in ägyptische Hieroglyphen als auch in akkadische Keilschrift (die Umgangssprache der damaligen Diplomatie) übersetzt. Das zweisprachige Dokument illustriert, welch wichtige Rolle die Übersetzung in der Diplomatie spielte – selbst zwischen verfeindeten Völkern wie den Ägyptern und den Hethitern.
Der Staatsvertrag beendete den jahrelangen Krieg zwischen den beiden Königreichen. Er enthielt genaue Abschriften in beiden Sprachen. Diese Übersetzungen gewährleisteten das für die Übereinkunft nötige gegenseitige Verständnis. Die zweisprachigen Vertragsdokumente belegen, dass Übersetzung ein politisches Werkzeug war, das Vertrauen schuf, Kriege verhinderte und Macht festigte – zumal beide Herrscher als Sieger dargestellt wurden.
3. Bibel und Exegese: die «Septuaginta» (3. bis 1. Jahrhundert vor Christus)
Vom 3. bis ins 1. Jahrhundert vor Christus hinein übersetzten jüdische Gelehrte in Alexandria das hebräische Alte Testament ins Griechische und schufen so die «Septuaginta». Bei ihr handelte es sich allerdings nicht um eine streng wörtliche Übersetzung. Stattdessen lag der Schwerpunkt des Textes auf Auslegung und Verständlichkeit. Dieser Ansatz löste eine der ersten Kontroversen in der Geschichte der Übersetzung aus, nämlich jene um den Konflikt zwischen wortgetreuer Wiedergabe und Lesbarkeit.
Die «Septuaginta» – weit verbreitet und im Neuen Testament zitiert – übte entscheidenden Einfluss auf die frühchristliche Kirche aus. Obendrein wurde sie zum Massstab für die Übersetzung kirchlicher Texte, bei denen die Vermittlung spiritueller Inhalte oft wichtiger war als die perfekte Reproduktion einer Struktur. Diese Ära stellt einen Wendepunkt dar: Übersetzungen begannen religiöses Selbstverständnis und dogmatische Auslegung zu prägen.
4. Lateinische Tradition und Volksmund (4. bis 9. Jahrhundert)
Latein war die universale Sprache des europäischen Mittelalters. Damals übersetzte der Kirchenvater Hieronymus die Bibel ins Lateinische (und schuf die «Vulgata»). Alfred der Grosse von England indessen bemühte sich um die Erstellung altenglischer Bibel-Übersetzungen. Beide Männer wurden zu Wegbereitern für die Übersetzung religiöser und philosophischer Schriften in Regionalsprachen. Diese Übersetzungen läuteten einen Wechsel der Macht ein – weg von den Institutionen und hin zum Volk.
Die «Vulgata» von Hieronymus blieb über ein Jahrtausend lang die offizielle Bibel der katholischen Kirche. Die Bemühungen Alfreds des Grossen wiederum bezweckten die Ausbildung von Klerus und Volk in ihrer jeweiligen Muttersprache. Ziel war die Alphabetisierung und die Förderung des intellektuellen Wachstums. Diese Initiativen verlagerten die Übersetzung aus dem Elfenbeinturm der Gelehrsamkeit in die Hände des Volkes.
5. Hochburg des Wissens: Übersetzungen im Islam (8. bis 10. Jahrhundert)
Vom 8. bis 10. Jahrhundert wurde das Haus der Weisheit in Bagdad zu einem Brennpunkt der wissenschaftlichen Übersetzung. Universalgelehrte wie Hunain ibn Ishaq übersetzten Texte aus dem Griechischen, Farsi und Sanskrit ins Arabische. Insbesondere die Übersetzungen der medizinischen Schriften von Galen hatten massgebliche Auswirkungen auf die Wissenschaft des Morgen- und Abendlands. Man schrieb das Goldene Zeitalter der Übersetzung.
Übersetzungen galten als moralische Pflicht und wurden von staatlicher Seite gefördert. Übersetzer adaptierten und verbesserten die Texte der Antike und kommentierten diese häufig auch. Dieser Schmelztiegel des Wissens sollte sich später über Europa ergiessen und dort die Renaissance befeuern. So wurden zum Beispiel die arabischen Fassungen der Schriften des Aristoteles zu einem Kernelement europäischer Universitätslehrpläne.
6. Kulturübergreifende Kollaboration: Toledo (12. bis 13. Jahrhundert)
Im Spanien des Mittelalters war Toledo ein Drehpunkt, wo christliche, jüdische und muslimische Gelehrte arabische Werke ins Lateinische übersetzten. Dank dieser Anstrengungen kehrten Philosophen wie Aristoteles in den europäischen Diskurs zurück und wurden zu Treibern der Renaissance. Diese vielsprachige Kollaboration ist noch heute ein Musterbeispiel für die Jahrhunderte alte Tradition der Wissensförderung durch Übersetzung.
Interessant ist, dass die Übersetzungsarbeit oft in zwei Schritten ablief: Ein arabischer Muttersprachler übersetzte in die lokale romanische Sprache, und ein christlicher Gelehrter übertrug diese Übersetzung dann ins Lateinische. Die Abläufe waren chaotisch, polyglott und zutiefst kollaborativ – was nur beweist, dass es beim Übersetzen seit jeher um die Zusammenarbeit zwischen Menschen geht.
7. Revolution Druckerpresse: Gutenberg und seine Wirkung (1444)
Als Johannes Gutenberg um 1444 in Deutschland seine Druckerpresse mit beweglichen Typen vorstellte, veränderte er damit schlagartig die Methoden zur Aufzeichnung, Reproduktion und Übersetzung von Wissen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit konnten Bücher als Massenprodukt hergestellt werden – und damit um einen Bruchteil der Kosten für die zeitaufwendigen manuellen Textkopien.
Gutenbergs Erfindung beschleunigte die Übersetzung religiöser und akademischer Werke und eröffnete einem breiteren Publikum Zugang zu Informationen in zahlreichen Sprachen. Kerntexte wie die Bibel wurden innerhalb kürzester Zeit übersetzt, gedruckt und in ganz Europa verbreitet, wo sie zur Alphabetisierung beitrugen und Ausbildung und Religion revolutionierten. Die Druckerpresse legte den Grundstein für das moderne Verlags- und Lokalisierungswesen.
8. Glaube, wie ihm der Schnabel gewachsen war: die Bibeln der Reformation (14. bis 17. Jahrhundert)
Kirchenreformatoren wie Martin Luther (deutsche Bibel), William Tyndale (englisches Neues Testament) und John Wycliffe (englische Bibel von 1382) sorgten für die weitläufige Verbreitung der Heiligen Schrift. Die King-James-Bibel (King James Version, KJV) (1611) sollte einer der wirkungsvollsten englischsprachigen Texte werden. Diese Entwicklungen definierten das Wechselspiel zwischen Sprache, Glauben und Selbstverständnis neu.
In jener Zeit galt Übersetzung als radikale Tat und wurde zuweilen mit dem Tod bestraft. Tyndale wurde für seine Bemühungen hingerichtet, aber Luthers Werk trug zur Standardisierung der deutschen Sprache bei. Diese Bibeln haben nicht nur die Kirche verändert – sie formten nationale Identitäten und die Entwicklung der modernen europäischen Sprachen.
9. Wie man den Code einer Kultur knackt: der Stein von Rosette (entdeckt 1799, verfasst 196 vor Christus)
Der 1799 entdeckte Stein von Rosette enthält einen auf Griechisch, Demotisch und in ägyptischen Hieroglyphen verfassten Erlass aus dem Jahr 196 vor Christus. Der Stein versetzte Jean-François Champollion in die Lage, die altägyptische Bildsprache zu entschlüsseln, und wurde damit zu einem der berühmtesten Artefakte in der Geschichte der Übersetzung. Ohne ihn wären uns weite Teile der schriftlich niedergelegten Geschichte Ägyptens verschlossen geblieben.
Denn der Stein von Rosette ist nicht nur inhaltlich bedeutend, sondern vor allem aufgrund der Tatsache, dass er in drei Sprachen abgefasst ist. Durch den Vergleich des griechischen Textes mit den geheimnisvollen Hieroglyphen entwickelten Linguisten eine Methode, die es ermöglichte, Tausende von Jahren ägyptischer Zivilisation zu entschlüsseln. Womit der Stein von Rosette zum ultimativen Dekodierring wurde.
10. Übersetzungstheorie: von Cicero bis Schleiermacher (1. Jahrhundert vor Christus bis 19. Jahrhundert)
Die Renaissance befasste sich nicht nur mit Kunst und Wissenschaft, sondern sie revolutionierte auch die Übersetzung. Römische Intellektuelle, darunter Cicero, und später der deutsche Philosoph Friedrich Schleiermacher vertraten unterschiedliche Ideale: Sollte die Leserschaft die Übersetzung als natürlich empfinden, oder sollte der Charakter des Originaltexts beibehalten werden? Diese Kontroverse zwischen Verhäuslichung (Lokalisierung) und Verfremdung bildet noch heute einen Angelpunkt der Übersetzungsgeschichte.
Cicero und Horaz bevorzugten die sinngemässe Übersetzung, insbesondere im rednerischen oder dichterischen Kontext. Der in den 1800er-Jahren tätige Schleiermacher hingegen trat für die Erhaltung der Fremdheit des Textes ein. Diese Ideen bildeten das Fundament der modernen Übersetzungswissenschaften und der Evolution des Übersetzers zum Vermittler und Schöpfer.
11. Präzision und Gelehrsamkeit: von der Aufklärung ins Industriezeitalter (18. bis 19. Jahrhundert)
Parallel zum Aufkommen von Nachschlagewerken, Grammatiken und wissenschaftlichen Gesellschaften im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich die Übersetzung zum eigenständigen Beruf. Der chinesische Denker Yan Fu brachte wissenschaftliche Schriften aus dem Westen nach China und entwickelte dabei eine ganz eigene Übersetzungstheorie: «Treue, Ausdrucksstärke, Eleganz».
Zur selben Zeit entwarfen staatliche Akademien linguistische Normen, und Übersetzer arbeiteten im Dienst von Reich, Wissenschaft und Diplomatie. Durch Yan Fus Übersetzungen gelangten Ideen wie der Darwinismus nach China, was einen noch umfassenderen Wandel signalisierte: Übersetzung wurde zum Treiber von Modernisierung und geistiger Unabhängigkeit.
12. Die erste maschinelle Übersetzung (1954)
Im Jahr 1954 veranstalteten die Georgetown University und IBM ein erstes öffentliches Experiment zur maschinellen Übersetzung: Unter Anwendung von nur sechs Grammatikregeln übersetzte man 60 russische Sätze ins Englische. Obwohl das Experiment noch höchst rudimentär war, läutete es ein neues Kapitel in der Geschichte der Übersetzung ein – die Computerlinguistik war geboren.
Die Demonstration stiftete erhebliche Aufregung hinsichtlich des Potenzials der Automatisierung, insbesondere während des Kalten Krieges, als die Nachfrage nach der raschen Übertragung russischer Texte ins Englische extrem hoch war. Zwar verlief der Fortschritt langsamer als erwartet, aber er ebnete doch den Weg für jahrzehntelange Forschungen. Und er wurde zum Grundpfeiler der modernen Übersetzungsmaschinen.
13. Im Werkzeugkasten der Übersetzer: CAT und TMs (1990er-Jahre)
Zu Anfang der 1990er-Jahre begannen Übersetzer, Werkzeuge zur computergestützten Übersetzung (CAT) zu verwenden. Software wie Trados führte Translation Memorys (TMs) und Terminologiedatenbanken ein, womit sich repetitive Arbeitsabläufe schneller und einheitlicher erledigen liessen. Diese Werkzeuge bestimmen die Arbeit der Berufsübersetzer bis heute.
CAT-Tools haben menschliche Übersetzer nicht etwa ersetzt – sie haben sie besser gemacht. Dank der Erkennung bereits übersetzter Textsegmente konnte man sich auf Feinheiten konzentrieren und gleichzeitig die Einheitlichkeit wahren. Mit Hilfe dieser Entwicklungen konnten im digitalen Zeitalter umfangreiche Lokalisierungsprojekte und mehrsprachige Content-Strategien umgesetzt werden.
14. Neuronale Netze und KI in Echtzeit (seit 2010)
Anfang der 2010er-Jahre ereignete sich ein Quantensprung in Textqualität und Kontextbewusstsein: die neuronale maschinelle Übersetzung (NMT). Dienste wie DeepL und Google Translate boten schnelle, verhältnismässig akkurate Übersetzungen. Doch auch diese Werkzeuge können Feinheiten, Ton oder kulturelle Zusammenhänge verfehlen, weswegen die Prüfung durch den Menschen (Post-Editing) nach wie vor erforderlich ist.
Im Gegensatz zu den alten regelbasierten oder statistischen Systemen der maschinellen Übersetzung kann NMT von riesigen Mengen an mehrsprachigen Daten lernen. Sie kann ganze Satzstrukturen vorhersagen und damit gewandtere, «menschlichere» Ergebnisse erzielen. Doch bei vertraulichen oder hoch spezialisierten Inhalten sind menschliche Berufsübersetzer nach wie vor unverzichtbar.
15. Der Faktor Mensch: Warum man Übersetzer immer noch braucht (heute und in Zukunft)
Trotz aller technologischen Fortschritte handelt es sich bei der Übersetzung nach wie vor um ein zutiefst menschliches Unterfangen. Gelehrte wie Lawrence Venuti und Damion Searls betonen, dass Ton, Subtext und emotionaler Rhythmus für den Algorithmus nicht zu entschlüsseln sind. Kulturelles Gespür und ethische Urteilsfähigkeit können nicht so einfach automatisiert werden. Und so bleibt das Post-Editing einer der wichtigsten menschlichen Arbeitsschritte bei der maschinellen oder KI-Übersetzung.
Sprache knüpft sich an Identität, und Bedeutung ist mehr als Wortschatz. Ob bei juristischen Verträgen, Gedichten oder Werbeslogans – menschliche Übersetzer lesen zwischen den Zeilen. Sie stellen sicher, dass Ihre Nachricht nicht in der Übersetzung verloren geht. Denn das richtige Wort – das «mot juste» – zählt.
Warum SwissGlobal die Geschichte der Übersetzung wichtig ist
- Ein Brückenschlag über Jahrtausende: Wir bauen auf Tausende von Jahren Übersetzungsgeschichte, um Ihrer Organisation unsere Dienstleistungen anbieten zu können.
- Zielführende Technologie: Werkzeuge sind nützlich, aber menschliche Erfahrung sichert Qualität und Zuverlässigkeit.
- Kulturelle Klarheit: Jedes Wort hat seine Bedeutung – grenz- und branchenübergreifend.
- Tradition und Innovation: Wenn wir die Vergangenheit verstehen, können wir eine zukunftssichere Kommunikation gewährleisten.
Wir bei SwissGlobal schätzen die Vergangenheit – und wir arbeiten an vorderster Front der Übersetzungstechnologie, wo Sprache und Vertrauen Hand in Hand gehen und Worte die Welt bewegen. Kontaktieren Sie uns noch heute, wenn Sie Übersetzungsbedarf haben.
-
Geschichte der Übersetzung
Sprachdienstleistung
Übersetzung